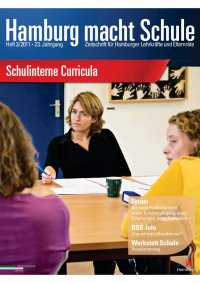
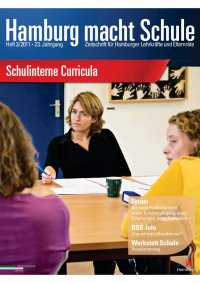
Erste Erfahrungen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Informationen zur Evaluation
Hamburg macht Schule 3|2011 18 Thema Einleitung sie bewusst ein pragmatisches Vor- gehen – »weniger ist oft mehr« – und beschränken sich in der Entwicklungs- arbeit zunächst auf einige Felder. Zum anderen machen sie sich die Vorteile eines verbindlichen, aber individuell an die Bedingungen und Bedürfnisse der Schule angepassten Schulcurriculums deutlich. Dies zeigt sich z.B. in dem In- terview mit Jörg Behnken über die Ar- beit an der Anne Frank Schule, S. 22f. Darüber hinaus spielt die Fortbildung und Schulberatung eine große Rolle bei der Unterstützung der Schulen in die- sem Prozess. Jochen Schnack stellt dar, welche Unterstützungsformen das LI anbietet (vgl. S. 19). Kompetenzorientierung: Wie unter- richtet man Kompetenzen? Haben Leh- rerinnen und Lehrer die Qualifikation, den Unterricht konsequent kompetenz- orientiert zu gestalten? Kompetenzen können nicht einfach gelehrt werden. Es müssen Lernsituationen und Aufgaben entwickelt werden, an denen Schüle- rinnen und Schüler diese erwerben kön- nen. Dabei ist vor allem der kumulative Aufbau eine große Herausforderung. Der Erfahrungsbericht von Veronika Pilscheur macht deutlich, wie die Fach- schaft Deutsch des Gymnasiums Altona sich gemeinsam dieser Aufgabe stellt (vgl. S. 28 f.). Neue Teamstrukturen schaffen: Wie arbeitet man gemeinsam an einer kom- plexen Aufgabe? Diese Herausforderung ist umso größer, je weniger man sich auf gewachsene Strukturen stützen kann. Dies ist bei der Entwicklung des Fach- curriclums für den neuen Lernbereich Naturwissenschaften an der Stadtteil- schule der Fall. Verschiedene Fachbe- reiche und Inhalte stoßen aufeinander. Die Erfahrungen an der Heinrich Hertz Schule zeigen, dass eine gute Organisa- tion der Teamsitzungen, Hospitationen im fachfremden Unterricht und die Konzentration auf fächerübergreifende Lernkontexte hilfreich sind, wie Chris- tian Pape darstellt (vgl. S. 24f.). Komplexität des Instruments: Wie kann die Unterrichtsgestaltung für einzelne Fächer mit übergreifenden Zielen und dem Schulprogramm der Schule verbunden werden? Ist es mög- lich, Kompetenzorientierungen sowohl fachbezogen zu strukturieren als auch fachübergreifend zu verknüpfen? Die Entwicklung eines schulinternen Curri- culums umfasst so viele Bausteine und Ebenen, dass eine übersichtliche Struk- tur und erst recht eine alltagstaugliche Darstellung schwierig ist. Die Grund- schule Furtweg entwickelt für dieses Problem eine webbasierte Lösung. Ursu- la Scheller, Dirk Voss und Karsten Patzer stellen die Entwicklung eines webbasier- ten Curriculums und erste Erfahrungen vor (vgl. S. 20f.). Curriculum und Schulentwicklung verknüpfen: Ist die Verknüpfung von Curriulumarbeit und Schulentwick- lung nicht zu komplex? Ist der Ent- wicklungsprozess von Schulen nicht oftmals auf ganz andere Schwerpunkte ausgerichtet? Arbeiten Schulen z.B. an der Gestaltung eines individualisierten Unterrichts, erscheint die Aufgabe ein kompetenzorientiertes Curriculum zu entwickeln, eher aufgesetzt und extern motiviert. Im Erfahrungsbericht der Stadtteilschule Bergedorf beschreibt Herwig Sünnemann, dass es auch bei größeren Schulentwicklungsschritten immer die Notwendigkeit gibt, diese konkret an den Unterricht anzuknüp- fen und als verbindliches Konzept zu formulieren. Somit ist die Unterrichts- entwicklung immer auch schon ein Teil Curriculumentwicklung (vgl. S. 26f.). Die Notwendigkeit der Curriculumar- beit ist für die allgemeinbildenden Schu- len erst mit den neuen Bildungsplänen konkret geworden. Die Erfahrungs- berichte zeigen, dass es erste Ansätze gibt und Schulen sich mit Engagement der Aufgabe stellen. Hilfreich kann für sie der »Blick über den Zaun« auf die berufsbildenden Schulen sein. Diese können schon auf eine längere Traditi- on der schulinternen Curriculumarbeit zurückgreifen. Mit der Ausrichtung des Unterrichts an Lernfeldern und beruf- lichen Aufgabenstellungen, für die es bundeseinheitliche Handreichungen nur auf einem sehr abstrakten Niveau gibt, ist dort die Notwendigkeit der Konkre- tisierung und Ausdifferenzierung kon- sequent auf die Ebene der Einzelschule verlagert. Im Erfahrungsbericht der G17 von Susanne Dwinger und Torsten Janssen wird deutlich, wie erfahren und professionell die Curriculumarbeit an berufsbildenden Schulen angegangen wird (vgl. S. 30f.). Literatur Bastian, Johannes (2008): Schulinterne Curriculumarbeit. Hilfe für die Unter- richstentwicklung? In: PÄDAGOGIK H. 4/2008, S. 6–11 Behörde für Schule und Berufsbildung (2011): Bildungsplan Grundschule. Auf- gabengebiete. Hamburg. Abgerufen unter: http://www.hamburg.de/conten- tblob/2481804/data/aufgabegebiete-gs. pdf Kleinschmidt-Bräutigam, Mascha/Mei- erkord, Ursula (o. Jg.): Schulinternes Curriculum – ein Baustein zur Quali- tätsentwicklung des Unterrichts. Berlin Klieme, Eckhardt u.a. (2007): Zur Ent- wicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Bonn/Berlin Lersch, Rainer: Das Schulcurriculum. Der entscheidende Impuls für die Unter- richtsentwicklung. In: Lernende Schule H. 54/2011, S. 9–11 Sievers, Thomas (2008): Vom Projekt- curriculum zum Methodencurriculum. In: PÄDAGOGIK H. 4/2008, S. 26–31 Sloane, Peter F.E.: Schulnahe Curricu- lumentwicklung. In: Grammlinger, F./ Tramm, T. (Hg.) (2003): Lernfeldansatz zwischen Feiertagsdidaktik und All- tagstauglichkeit. Themenheft der Zeit- schrift Berufs- und Wirtschaftspädago- gik bwp@. Abgerufen unter: http://www. bwpat.de/ausgabe4/ Steinemann, Sandra (2008): Koopera- tive Curriculumentwicklung. Wie kann Teamarbeit bei der Erarbeitung von Curricula gelingen? In: PÄDAGOGIK H. 4/2008, S. 16–19 Dr. Julia Hellmer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg, Fakultät 4, Fachbereich 2, Arbeitsbereich Schulpädagogik/Schulforschung. E-Mail: Julia.Hellmer@uni-hamburg.de